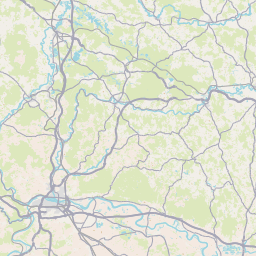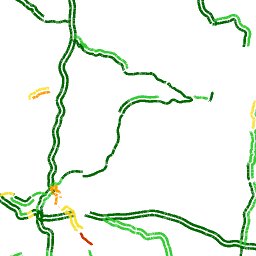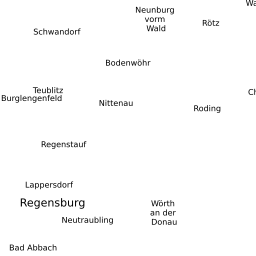Hamas-Israel-Krieg "Niemand braucht eine weitere politische Kampfzone auf der Fusion"
Die Statements des Fusion-Festivals zum Nahostkonflikt bringen die Veranstalter in Bedrängnis und zeigen, dass sich in diesem Konflikt die Fronten nicht fusionieren lassen. In der Festival- und Clubkultur scheint gerade viel kaputt zu gehen.

Feiern, Tanzen, den Wahnsinn der Welt vergessen – das verspricht kaum ein Festival so sehr wie die Fusion. Fast 70.000 Menschen erschaffen sich auf der seit jeher politischen Veranstaltung für ein paar Tage eine autonome Zone, einen "Ferienkommunismus", wie es die Veranstalter nennen. "Menschen aus verschiedenen Szenen zusammenbringen, Barrieren abbauen, kommunizieren und Neues und Unbekanntes erlebbar machen", lautet das Motto des Festivals.
Doch seit dem 7. Oktober und dem darauffolgenden Krieg in Gaza ist fraglich, wie ein gemeinsames Paralleluniversum möglich sein soll. Ob Berlinale, Berghain oder die Kurzfilmtage in Oberhausen – kaum eine Kulturveranstaltung scheint gerade ohne Kontroverse um Nahost auszukommen. Denn die gegensätzlichen Positionen in der Debatte sind unversöhnlich: Die eine Seite bekennt sich klar zu Israel – und übersieht darüber das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Auf der anderen Seite wollen Teile des Pro-Palästina-Lagers nicht nur den Krieg beenden, sondern den israelischen Staat gleich mit.
Fusion: Kritik erlaubt, innerhalb zweier roter Linien
Kunst und Kultur sowohl von israelischen als auch palästinensischen Artists war in den vergangenen Jahren stets Teil des Fusion-Programms. Um zu vermeiden, dass der Nahost-Konflikt "eskalativ auf der Fusion ausgetragen wird", veröffentlichte der hinter der Fusion stehende Verein Kulturkosmos im Februar ein sechs Seiten langes Statement.
Darin beschrieben sie zunächst ihre "Fassungslosigkeit, Wut und Trauer" angesichts "des unermesslichen Leids, welches die Palästinenser:innen ertragen mussten und weiter erleiden müssen." Gleichzeitig wandten sie sich gegen Antisemitismus. Denn: "Angesichts der Shoah trägt Deutschland eine kollektive Verantwortung, die aus unserer Sicht auch weiterhin besteht." Für ihr Festival wünschten sie sich durchaus Debatte und Protest, allerdings innerhalb zweier klarer roter Linien: Das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar, und die Unterstützung der Hamas ein No-Go.
Zwischen den Fronten: Boykott-Aufrufe und deutliche Kritik
Doch es zeigte sich, dass sich in diesem Konflikt die Fronten nicht fusionieren lassen. Ende Mai reagierte die Bewegung "Palästina spricht", die selbst Teil des Programms war. In einem offenen Brief mit dem Titel "Der Niedergang der Fusion" riefen sie zum Boykott des Festivals auf – aufgrund dessen Bekenntnisses zum Staat Israel. Die Fusion legitimiere mit ihrem Statement ein "Apartheid-Regime", hieß es da, und zeige eine "blinde Ausrichtung am zionistischen Projekt".
Die Veranstalter, offenbar interne Kritik in dieser Härte nicht gewöhnt, reagierten mit einem zweiten Newsletter – und verscherzten es sich nun auch noch mit dem Pro-Israel-Lager. Denn zuvor formulierte rote Linien wurden aufgeweicht und nun plötzlich Verständnis dafür geäußert, wenn jemand die Anerkennung des israelischen Staates problematisch findet. Auch sei es ein Fehler gewesen, nicht klar von "Völkermord" und "Apartheid" zu sprechen.
Nun sieht sich die Fusion Angriffen von beiden Seiten ausgesetzt – und will sich bis auf weiteres nicht mehr öffentlich äußern. Damit sind sie bei weitem nicht die erste Club- und Feier-Instanz, die im Zuge des Gaza-Kriegs ins Visier von Aktivist:innen gerät. Gegenüber der Streamingplattform Hör – von zwei Israelis in Berlin gegründet – gab es Boykottaufrufe, weil sie ein T-Shirt, das das Verschwinden Israels andeutet, nicht akzeptierten. Auch Berliner Clubs wie das About:Blank wurden angefeindet.
"Die falschen Share Pics reichen um als DJ Autritte zu verlieren"
Der SZ-Journalist Jan Stremmel hat zur Clubkultur recherchiert und beschrieben, wie schnell man sich zur Zielscheibe machen kann, wenn man sich zum Nahost-Krieg äußert. "Es reicht mittlerweile, die falschen Share Pics auf Instagram zu teilen, um als DJ Auftritte zu verlieren", sagt er im Zündfunk. Es komme vor, "dass an die Wand eines Clubs plötzlich Intifada geschmiert wird. Dass das rote Dreieck der Hamas an die Wand gemalt wird, oder dass Pappbecher voll mit Exkrementen im Clubgarten landen" – nur weil sich Clubs zum Beispiel gegen Antisemitismus geäußert haben.
Stremmel beobachtet einen Riss, der durch die Szene geht. Einer Szene, die sich eigentlich darüber definiert, divers und inklusiv zu sein, in der die Identitäten eigentlich an der Clubtür abgegeben werden, um gemeinsam zu tanzen. Diese Zeit sei nun vorbei. "Ich habe das Gefühl, dass inzwischen eine Politisierung stattgefunden hat, die diesen ganzen Konflikt auf extrem einfache Schwarz-Weiß-Schemata runterbricht und sich damit letztlich selbst zerfleischt", sagt Stremmel.
Wir alle verlieren mit Festivals und Clubs wichtige Rückzugsorte
Allerdings: Wo, wenn nicht in der Kunst und Kultur, sollen denn die Räume sein, um Brücken zu bauen, um Gegensätze zu versöhnen? Wo, wenn nicht in den Clubs und auf den Tanzflächen, soll denn das Leid und der Hass der Welt wenigstens für einen Moment vergessen werden? Für die Minderheiten und Misfits, für queere Menschen, und eben auch für Betroffene von Antisemitismus und antiarabischen Rassismus sind Clubs wichtige Rückzugsorte, Bastionen der Freiheit, und es wäre einfach nur fatal, wenn diese nun auch noch der Polarisierung und dem Hass zum Opfer fielen.
Dass die Fusion nach wie vor ein Rückzugsort sein will, geht auch aus dem Folge-Newsletter hervor. "Lasst uns zusammenkommen und gemeinsam feiern, anstatt uns weiter voneinander zu entfernen", lautet der Aufruf, denn: "Niemand braucht eine weitere politische Kampfzone auf der Fusion, in der Menschen sich oder ihre Meinungen gegenseitig delegitimieren. Lasst uns das Festival nutzen, um Energie zu tanken und Kräfte zu sammeln für die Kämpfe, die uns noch bevorstehen werden."
"Standing Together": Leid aller Betroffenen in den Vordergrund stellen
Gleichzeitig haben die Veranstalter angekündigt, wachsam sein zu wollen, sowohl gegenüber antisemitischen als auch anti-palästinensischen Diskriminierungen. Dafür wolle man die Security sensibilisieren und "verstärkt Menschen mit jüdischen und arabisch/palästinensischen Identitäten und Backgrounds einbinden."
Dass es möglich ist, sich nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern das Leid aller Betroffenen in den Vordergrund zu stellen, zeigt die Bewegung "Standing Together". Die Graswurzelbewegung setzt sich in Israel für den Frieden und einen israelisch-arabischen Dialog ein. Der Leiter der Initiative Alon-Lee Green gab dem Zündfunk schon im Oktober eine klare Botschaft mit: "Stellt euch nicht auf irgendeine Seite, sondern stellt euch auf die Seite der Menschen".