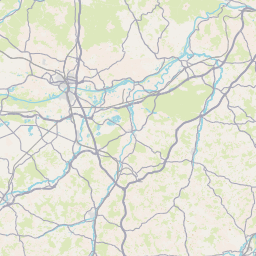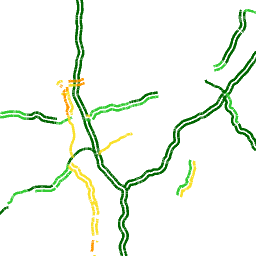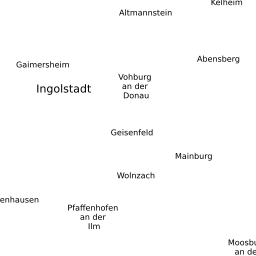Doku über Rassismus im Fußball "Wo Kimmich falsch lag: Dass man die Frage nicht stellen darf"
21 Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer WDR-Umfrage mehr "weiße Deutsche in der Nationalmannschaft". Ist nicht allein die Umfrage schon rassistisch? Warum es speziell bei Studien zu Rassismus und Diskriminierung auf die Fragetechnik ankommt.

Die Diskussion um die ARD-Doku "Einigkeit und Recht und Vielfalt" von Philipp Awounou hat hohe Wellen geschlagen. Aber das lag gar nicht unbedingt an deren Inhalt, der kritisch die Entwicklungen im Fußball seit dem sogenanntem Sommermärchen 2006 nachvollzogen hat. Viel mehr dreht sich die Debatte um eine repräsentative Umfrage, die der WDR im Rahmen des Films bei infratest-dimap in Auftrag gegeben hatte.
Denn in der Umfrage gaben 21 Prozent der Befragten an, dass sie es besser fänden, wenn wieder mehr Spieler mit weißer Hautfarbe in der deutschen Nationalmannschaft spielen würden. Kurz vor der Europameisterschaft wird nun diskutiert, was denn nun rassistisch sei, die Umfrage oder unsere Gesellschaft.
Hätte man diese Umfrage zu Rassismus im Fußball also nicht machen sollen?
Laing ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung. Er berät die Bundesregierung in Diversity Fragen.
Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich dazu und sagte: "Ich würde sehr viele Spieler sehr vermissen wenn sie nicht hier wären. Dementsprechend ist das absolut rassistisch und hat keinen Platz in der Kabine. Gerade wenn man überlegt, dass wir vor einer Heim-EM stehen, wo es darum geht das ganze Land zu vereinen". Professor Lorenz Narku Laing ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung in Bochum und berät zu Rassismusfragen unter anderem das Bundeskanzleramt. Laing stimmt Kimmich zwar zu. Doch Umfragen wie die des WDR müsse man trotzdem machen, so Laing.
Lorenz Narku Laing: Wo Joshua Kimmich falsch lag, ist, dass man die Frage nicht stellen darf. Weil hier wird der Rassismus sichtbar, den so viele Menschen jeden Tag erleben, auch ich. Und dieser Rassismus, den kann man nur beheben, bekämpfen und lösen, wenn wir das Problem Rassismus verstehen und es sehen können.
Alexandra Martini: Der WDR ist also nur der Überbringer der schlechten Botschaft von einer Realität, die in der Gesellschaft sowieso vorhanden ist? Also don't shoot messenger?
Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der ein nicht unerheblicher Teil der Menschen rechte Parteien wählt. Wir konnten in der Mitte Studie immer wieder sehen, dass es große Vorurteile gegenüber Menschen gibt, die Schwarz sind, die Muslime sind, die geflüchtet sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es viele Mordanschläge auf von Rassismus betroffene Menschen gab: in Hanau und Halle und Berlin und München und an anderen Orten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo dieses unsägliche Partyvideo aus dem hohen Norden erst wenige Tage alt ist. Wir müssen uns daher eingestehen, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir bearbeiten müssen und dürfen dann nicht dem Botschafter böse sein, der das sichtbar gemacht hat. Übrigens hat das ja auch eine antirassistische Botschaft, denn die Mehrheit der Menschen haben ganz klar gesagt: "Ich finde das falsch". Diese antirassistische Mehrheit, die in dieser Frage erneut sichtbar wurde, die hat mir tatsächlich als Schwarzer Mensch sogar ein Stück weit Hoffnung gemacht.
Trotzdem sind 21 Prozent ja nicht unerheblich. Hätte man die Umfrage-Statements genau so formulieren sollen? Eine Frage lautete: "Ich finde es schade, dass der derzeitige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft türkische Wurzeln hat". Da geht es um İlkay Gündoğan, der in Gelsenkirchen geboren ist. Seine Eltern kamen als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei. Auf mich wirkt diese Formulierung "schade" merkwürdig, wenn nicht sogar zynisch und suggestiv. Wie blicken Sie denn darauf?
In der Vorurteils- und Diskriminierungsforschung wenden wir verschiedene Mitteln an, um gute Forschungsergebnisse zu bekommen. Hier haben wir es mit der "Attitude-Forschung" zu tun, also mit der Einstellungsforschung. Hier nutzen wir manchmal Fragen, um die Leute so ein bisschen auch herauszufordern zu gesellschaftlichen Spannungen. Es wurde nämlich in vielen Studien sichtbar, dass, wenn die Menschen das Gefühl haben, der Interviewer stimmt dieser Aussage auch zu, der findet es gar nicht so tragisch, dann sinkt die Angst vor der mangelnden sozialen Akzeptierbarkeit der Antwort erheblich. Und die Leute sind auf einmal bereit, ihre diskriminierenden Haltungen zu äußern, die sie zwar vielleicht jeden Tag haben, aber die sie an vielerlei Stelle nie so explizit sichtbar machen würden.
An der Umfrage hängt sich jetzt gerade die Debatte auf, die aber ja Teil der Dokumentation "Einigkeit und Recht und Vielfalt" von Philipp Awounou ist, die verschiedene Perspektiven auf Fußball und Rassismus abbilden will. Der Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi kritisiert in der Doku, wie ihm als Mensch mit albanischen Wurzeln Interviewfragen gestellt werden:
"Wer singt die Nationalhymne mit? Wer singt sie nicht mit? Ist man integriert? Ist man nicht integriert, ist man dankbar dafür ist, für Deutschland spielen zu dürfen oder nicht. Ich habe auch oftmals das Gefühl gehabt, wenn ich in Interviews saß und man mich gefragt hat: Ja, wie fühlst du dich denn eigentlich? Und ich fand die Frage immer so unangenehm, weil ja, wie soll ich mich fühlen? Ich fühle mich als Mensch."
Shokdran Mustafi über Rassismus im Fußball.
Hat Fußball das Potenzial, unsere Gesellschaft wirklich vielfältiger zu machen und Rassismus abzubauen? Oder fördert es den Rassismus eher, wenn man in Nationalmannschaften denkt, Nationalhymnen singt, über Zugehörigkeit diskutiert?
In der Forschung sprechen wir immer vom guten, inklusiven und vom schlechten, exkludierenden Nationalismus. Es gibt einen Nationalismus, einen Patriotismus, wo man sagt: "Wir fühlen uns als Gemeinschaft verantwortlich, wir bauen einen Sozialstaat auf, wir kümmern uns um einander, wir helfen dem Nachbarn". Es gibt einen Patriotismus, der sagt: "Wir als Deutsche sind heute ein friedvolles Volk und wollen keinen Krieg in die Welt bringen. Gleichzeitig gibt es auch einen explodierenden, einen bösen Nationalismus, der Krieg in die Welt, der Entzweiung, der Hass in die Welt bringen will." Das Zitat was Sie aus dieser großartigen Dokumentation gebracht haben, ist für mich so wertvoll. Weil es Menschen klar sein müsste, dass auch ich, der Steuern zahlt, der Arbeitgeber ist, der Professor ist; obwohl ich also all die Dinge tue, von den Menschen sagen würden, dass sie "gut" sind, wenn man hier dazugehören will, erlebe ich trotzdem Rassismus.
Genau das zeigt auch diese Umfrage, dass diese Fußballspieler, die sich für uns verbürgen, die für unser Land spielen, die sich "benehmen", die Steuern zahlen, die erfolgreich sind, die werden trotzdem von manchen Menschen gehasst. Das entlarvt auf wunderschöne Art und Weise, dass die Menschen, die eine rassistische Haltung gegenüber Menschen haben, aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft, keine guten Gründe dafür haben, sondern die hassen den Menschen, der Schwarz ist und vermeintlich schlecht integriert häufig genauso sehr wie den Schwarzen, der gut integriert ist.
Aus Ihrer Perspektive als ehemaliger Trainer und heutiger Sponsor einer Football-Mannschaft: Was kann jetzt positive antirassistische Impulse in den Sport bringen? Was erwarten Sie konkret von Verbänden und von Fans?
Wir brauchen eine bessere Repräsentation von Rassismus betroffenen Menschen in Spitzenfunktionen. Der Fußball, vor allem die Verbände, müssen Rassismus betroffenen Profis zur Seite stehen. Ich erinnere mich noch an die U21, als einige nicht-weiße Männer Tore verschossen haben im Elfmeterschießen und ein riesengroßer rassistischer Shitstorm über sie einbrach. Aber gerade Joshua Kimmich, dieser junge weiße Mann, der sofort sagt: Das ist rassistisch, das ist falsch und ich würde diese Menschen vermissen, zeigt den Antirassismus, den wir brauchen. Wenn heute in den Fußball-Kabinen, in den Vorstandsetagen der Verbände, aber auch in den Fanreihen jedes Mal, wenn etwas rassistisches passiert, mit der Klarheit von Kimmich und Nagelsmann Rassismus ansprechen würden, dann wäre das Problem von Rassismus im Sport sehr schnell geklärt.
Hier geht's zur ARD-Doku "Einigkeit und Recht und Vielfalt".