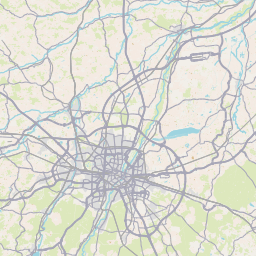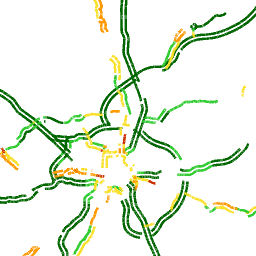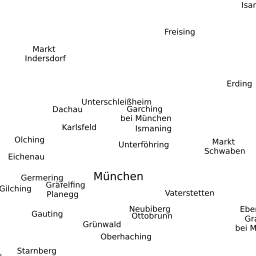Psycho-Onkologie Krebs seelisch gut überstehen
Eine Krebsdiagnose ist ein fundamentaler Einschnitt im Leben eines Menschen. Auch die psychischen Auswirkungen sind enorm - für Betroffene und Angehörige. Helfen kann die Psycho-Onkologie.
Stand: 19.10.2021 |Bildnachweis

Eine Krebsdiagnose ist ein fundamentaler Einschnitt im Leben eines Menschen. Alles ändert sich - von einem Tag auf den anderen. Selbstverständlich hat das auch Auswirkungen auf die Seele eines Menschen. Und es muss ein Weg gefunden werden, mit der Krankheit umzugehen.
Expertin:
Manchen Patienten hilft dabei positives Denken, andere brauchen eher Ablenkung. Zudem müssen Ängste bewältigt werden – vor Schmerzen, vor Hilflosigkeit, vor dem Tod. Und auch die Angehörigen und das medizinische Personal sind immensen Belastungen ausgesetzt: Sie wollen einerseits gerne helfen und brauchen andererseits mitunter selbst Unterstützung. In allen diesen Punkten Hilfestellung zu geben, ist Aufgabe der Psycho-Onkologie - eine große Herausforderung, gerade in Zeiten chronisch knapper Kassen.
Dem Text liegt ein Gespräch mit Dr. Pia Heußner zugrunde, leitende Oberärztin Psycho-Onkologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Standort Murnau.
Betroffene können sich direkt an den Verein Lebensmut e.V. wenden.
Der Schock der unerwarteten Krebsdiagnose steckt vielen Betroffenen lange in den Knochen. Wie geht man damit um? Hilft allein positives Denken? Die Psycho-Onkologie befasst sich mit den emotionalen Belastungen von Patienten und Angehörigen, wenn sie mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind.
Mit dem Schock der Diagnose umgehen
Am Anfang jeder Krebserkrankung steht für die Betroffenen der Schock der unerwarteten Diagnose. „Daraus entsteht für die meisten Patienten ein Katastrophenszenario. Die Welt wird von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt, ähnlich wie nach einem schweren Unfall“, sagt Dr. Pia Heußner, Psycho-Onkologin und Oberärztin am Klinikum Großhadern in München. Wie der Einzelne dann mit dieser emotionalen Herausforderung umgeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Einerseits von den Persönlichkeitsmerkmalen des Betroffenen, andererseits davon, ob ein funktionierendes soziales Umfeld da ist. Jemand, der schon immer sehr lösungsorientiert und pragmatisch war, geht mit der Herausforderung anders um als jemand, der immer schon am Leben gezweifelt hat.
Die geeignete Bewältigungsstrategie finden
Wenn die individuellen Krankheitsbedingungen geklärt sind, muss eine persönliche Bewältigungsstrategie gefunden werden. Den Prozess der Krankheitsbewältigung nennt man in der Fachsprache „Coping“. Zunächst ist es dabei wichtig, die Krebserkrankung nicht mehr als unabwendbare Katastrophe wahrzunehmen, sondern als Herausforderung, die bewältigt werden kann. Der Weg dorthin kann individuell sehr verschieden sein: Dem einen Patienten hilft es, jede Information über seine Erkrankung zu sammeln, die er bekommen kann. Für andere ist viel Ablenkung, etwa durch körperliche Aktivität oder leichten Sport, Musik oder Freunde, hilfreicher.
Flexibel bleiben
In verschiedenen Phasen einer Krebserkrankung können unterschiedliche Bewältigungsstrategien richtig sein. Unsichere Prognosen oder Rückfälle können die Lage drastisch verändern.
"Viele Patienten kommen mit ihrer persönlichen Coping-Strategie sehr gut zurecht, bis sich die Situation durch ein bestimmtes Ereignis plötzlich völlig anders darstellt. Dabei spielt nicht unbedingt eine Rolle, ob das jeweilige Ereignis vorhersehbar war oder nicht."
Dr. Pia Heußner
„Positives Denken“ hilft nicht jedem
Ein häufiges Stichwort bei der Bewältigung einer Krebserkrankung ist das sogenannte „Positive Denken“. Gerne wird eine solche Haltung von hilflosen Angehörigen oder Freunden gegenüber dem Patienten eingefordert. Aber: Das ist nicht für jeden der richtige Weg.
"Wenn Angehörige zu vehement positives Denken einfordern, kann das beim Betroffenen sogar Versagens- oder Schuldgefühle auslösen."
Dr. Pia Heußner
Gefühle zulassen?
Auch das Zulassen von Angst und Verzweiflung, manchmal aber auch das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Erkrankung kann in einzelnen Phasen wichtig und hilfreich sein. Allerdings darf das Verleugnen der Krankheit nie so weit gehen, dass die Therapie behindert wird oder abhängige Personen, wie z.B. Kinder dadurch in Gefahr geraten.
Grundsätzlich gilt: Wenn jemand positiv denken kann, kann das gut für ihn sein. Aber dafür, dass positives Denken den Krankheitsverlauf günstig beeinflusst, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise.
Lebensqualität als Krebskranker
Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht ist die Lebensqualität von Krebspatienten durchaus nicht in jeder Phase schlecht. Grundsätzlich beeinflussen fünf Hauptfaktoren die Lebensqualität:
- Körperliche Verfassung
- Seelisches Befinden
- Das soziale Gefüge, in das jemand eingebettet ist
- Die gesellschaftlichen und familiären Rollenfunktionen, die jemand einnimmt
- Spiritualität
Je nach Persönlichkeit des Patienten und Situation sind die einzelnen Faktoren von unterschiedlicher Gewichtung. Auch Betroffene, die körperlich in einem sehr schlechten Zustand sind, können ihre Lebensqualität als relativ gut empfinden, und hingegen physisch fitte Erkrankte in einer spirituellen Krise als sehr schlecht. Zur Erhaltung der Lebensqualität tragen auch eine möglichst schonende, nebenwirkungsarme Behandlung und ein respektvoller, selbstwertstützender Umgang mit dem Patienten bei.
Es gibt keine „Krebspersönlichkeit“
Was für die Bewältigung einer Krebserkrankung gilt, gilt auch für ihre Entstehung: Dafür, dass bestimmte Charakterzüge Einfluss auf die Bildung von Tumoren hätten, gibt es keine wissenschaftlich eindeutigen Belege. Das bedeutet: Die in den vergangenen Jahrzehnten so gerne beschworene "Krebspersönlichkeit", die für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich sein soll, gibt es nicht!
Die Angehörigen eines Krebspatienten sind häufig in einer besonders schwierigen emotionalen Situation: Einerseits möchten sie ihrem Verwandten oder Freund gerne helfen, andererseits sind sie selbst oft großen Belastungen ausgesetzt und würden ihrerseits von Unterstützung profitieren.
"Es ist auch für die Ärzte wichtig, dass sie die Angehörigen in ihrer Doppelrolle als Helfende und Hilfesuchende wahrnehmen und ihnen Unterstützung anbieten, wenn sie sie brauchen. Manchmal muss man den Angehörigen auch erst den Blick dafür schärfen,dass sie in einer Doppelrolle sind und dass es berechtigt ist, diese als Belastung zu empfinden."
Dr. Pia Heußner
Hilfe ist sehr individuell
Wie man als Angehöriger einen Patienten sinnvoll unterstützen kann, ist individuell sehr unterschiedlich. Entscheidend ist, dass beide Seiten in der jeweiligen Situation ihre gegenseitigen Bedürfnisse erkennen und annehmen. Auch die Frage, wie viel und welche Form der Hilfe gerade die richtige ist, kann nur im Einzelfall geklärt werden.
Tipp: Wichtig ist, dass man sich traut, den anderen zu fragen, was er möchte und was nicht.
Generell gilt: Dem Patienten so viel wie möglich von seiner Selbstständigkeit lassen und ihn nicht übertrieben schonen und pflegen.
Mit der Kraft haushalten
Angehörige setzen häufig ihre ganze Kraft ein, um einen Patienten bei der Bewältigung seiner Krebserkrankung zu unterstützen. Dabei gehen sie oft schon sehr frühzeitig an ihre physischen und psychischen Grenzen und darüber hinaus. In der Folge besteht die Gefahr, dass sie selbst physische oder psychische Probleme bekommen und behandelt werden müssen.
"Angehörige sollten ruhig den Mut haben, auch ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich Rückzugsräume für sich selbst verschaffen. Schwierig wird es meist dann, wenn die Person, die eigentlich die Fürsorgefunktion in einer Familie übernimmt, krank wird oder der Versorger ausfällt."
Dr. Pia Heußner
Mit Schuldgefühlen umgehen
Manche Angehörige entwickeln auch Schuldgefühle, weil jemand anderes als sie selbst an Krebs erkrankt ist. In solchen Fällen müssen die Betroffenen besonders intensiv betreut werden. Häufiger treten solche Emotionen bei Eltern auf, deren Kinder (egal in welchem Lebensalter) erkranken. Da kommt oft die Frage auf: 'Warum mein Kind und nicht ich? Ich habe mein Leben doch schon gelebt'.
Offen zu Kindern sein
Wenn Kinder als Angehörige von einer Krebserkrankung betroffen sind, versuchen Erwachsene instinktiv, sie weitestgehend zu schonen. Dabei ist es in der Regel viel schwieriger für Kinder, wenn man ihnen sagt, es sei alles in Ordnung, obwohl sie genau spüren, dass das nicht stimmt. Man sollte auch nie vergessen, dass Kinder mehr wahrnehmen, hören und sehen, als Erwachsene glauben. Und wenn sie sich dann ihre Informationen woanders holen müssen, z.B. in der Schule oder bei den Spielkameraden, wird alles nur noch verworrener und kastastrophaler. Außerdem sollte möglichst verhindert werden, dass Kinder irgendwelche Phantasien darüber entwickeln, was los sein könnte. Diese Phantasien sind häufig viel schlimmer als die Realität.
Tipp: Offen und in altersgemäßer Sprache mit Kindern über die Situation reden. Das gilt für Kinder in jedem Alter.
In der Psycho-Onkologie finden verschiedenste psychotherapeutische Verfahren Anwendung. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Gesprächs-, Verhaltens- und Entspannungstherapie. Welche Maßnahmen im Einzelfall sinnvoll sind, hängt von der individuellen Situation des Patienten ab.
Strukturen schaffen
Ist der Betroffene von der Gesamtlage stark überfordert, kann es hilfreich sein, mit strukturierenden verhaltenstherapeutischen Maßnahmen wie Tages- oder Wochenplänen zu arbeiten. Dabei ist es wichtig, mit für den Patienten überschaubaren Zeiträumen zu operieren. Psycho-Onkologen bezeichnen das als `Arbeiten im Hier und Jetzt`. Dadurch wird auch die Angst in Zeitfenster unterteilt.
Ängste bewältigen
Bei einer Krebserkrankung treten sehr reale Ängste im Zusammenhang mit einer lebensbedrohlichen Krankheit auf. Das unterscheidet sie von pathologischen Angststörungen wie zum Beispiel Klaustrophobie. Zu ihnen gehören die Furcht vor dem Tod, vor Schmerzen, die Angst vor Abhängigkeit von anderen oder, speziell in der Krebsnachsorge, die Furcht vor einer erneuten Erkrankung. Aufgabe der Psycho-Onkologie ist es, mit dem Patienten herauszufinden, wovor er sich fürchtet und was er dagegen tun kann. Das Ziel der Therapie ist: Der Betroffene soll Kontrolle über seine Angst bekommen und nicht umgekehrt. Manchmal kann es therapeutisch sogar sinnvoll sein, ein Angstszenario zu Ende zu denken.
Nach Ressourcen suchen
Ein wichtiger Ansatz in der psychoonkologischen Behandlung ist die ressourcenorientierte Therapie. "Wir müssen immer schauen: Welche Möglichkeiten hat der jeweilige Patient, zum Beispiel bei der Auswahl einer geeigneten Bewältigungsstrategie", erklärt Dr. Heußner. Je nach Persönlichkeit kann das Unterscheiden unwichtiger von wichtigen Aufgaben, moderate körperliche Bewegung in der Natur, positives Denken, Ablenkung oder auch eine Mobilisierung der Selbstheilungskräfte der richtige Weg sein.
Entspannen lernen
Vielen Patienten hilft es auch, sich zu entspannen. Das kann das Erlernen einer Entspannungstechnik wie Yoga, Autogenes Training oder Chi Gong bedeuten, aber genauso gut das Abschalten mit Hilfe von Musik, Lesen oder Malen. Entspannung hilft vielen Patienten, den nächsten Schritt in der Krankheitsbewältigung anzugehen.
Hypnose als Therapie
Hypnose kann als zusätzliche therapeutische Maßnahme in der Psycho-Onkologie sinnvoll sein, etwa bei der Bekämpfung körperlicher Symptome wie Übelkeit oder Schmerzen. Manche Patienten empfinden jedoch den veränderten Bewusstseinszustand als weiteren Kontrollverlust in einer ohnehin ausgelieferten Situation.
Kreativ sein
Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist der sogenannte „Kreative Ausdruck“. Hierbei werden in künstlerischer Betätigung (wie z.B. beim Malen) Emotionen verarbeitet. Das ist eine gute Möglichkeit für die, die sich der Sprache nicht bedienen wollen oder können oder ergänzend zur Gesprächstherapie. Manche Menschen entdecken dabei ganz neue Kreativitätspotentiale in sich.
"Ein großes Problem im Bereich der Psycho-Onkologie ist allerdings, dass in den akut-stationären Bereichen und auf dem Gebiet der Prävention, die Finanzierung seitens der Kostenträger nicht sichergestellt ist. Hier müsste die Politik gewährleisten, dass jeder Patient, auch in der akut-stationären Behandlungsphase, Zugang zu qualitätsgesicherter psychoonkologischer Versorgung hat."
Dr. Pia Heußner
Keine einheitliche Qualifizierung
Ein weiteres Problem der Psycho-Onkologie ist, dass es im Moment noch keine einheitlichen Qualifizierungsstandards in diesem Fachbereich gibt. Es existiert nicht einmal eine geschützte Berufsbezeichnung 'Psycho-Onkologe'. Jeder, der das möchte, kann sich so nennen. Das macht laut Dr. Heußner eine ordentliche Qualitätssicherung sehr kompliziert.