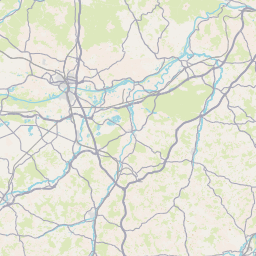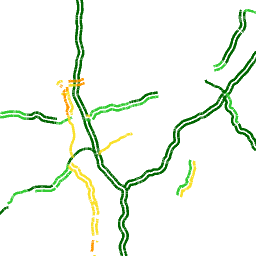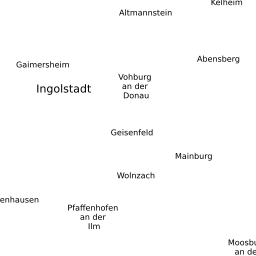Antikörper & Co. Krebstherapie im Wandel
Die Krebstherapie ist im Wandel: Neue Methoden berechtigen zu großer Hoffnung. Sie greifen Tumorzellen gezielter und individueller an oder befähigen und unterstützen gar das eigene Immunsystem, Krebszellen abzutöten. Wo setzt die moderne Immuntherapie an, wo die Antikörpertherapie? Wie unterscheiden sich die Verfahren? Für welche Patienten kommen sie in Frage?
Von: Sabine März-Lerch
Stand: 13.01.2025 |Bildnachweis

Chemotherapie, Operation, Bestrahlung – über viele Jahre bestand das Repertoire der Onkologie in der Behandlung von Krebs ausschließlich aus diesen Therapien. Mit bekannten Folgen: Auch unbeteiligte Zellen und gesundes Gewebe werden teils massiv geschädigt. Und mit bekannten Nebenwirkungen: Unverträglichkeiten, schlimme Übelkeit, Haarausfall.
Expertin:
Prof. Dr. med. Angela Krackhardt, Chefärztin der Medizinischen Klinik I, Onkologie, Pneumologie, Diabetologie, Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, Flensburg, und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Hämatologie und Onkologie; Leiterin der Arbeitsgruppe Translationale Immuntherapie
Doch die Krebstherapie ist im Wandel: Neue Methoden berechtigen zu großer Hoffnung. Sie greifen Tumorzellen gezielter und individueller an oder befähigen und unterstützen gar das eigene Immunsystem, Krebszellen abzutöten. Wo setzt die moderne Immuntherapie an, wo die Antikörpertherapie? Wie unterscheiden sich die Verfahren? Für welche Patienten kommen sie in Frage?
Der Text basiert auf Interviews mit Prof. Dr. med. Angela Krackhardt, Chefärztin der Medizinischen Klinik I, Onkologie, Pneumologie, Diabetologie, Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, Flensburg, und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Hämatologie und Onkologie; Leiterin der Arbeitsgruppe Translationale Immuntherapie
Kein Mensch ist identisch mit einem anderen Menschen, keine Krebserkrankung ist identisch mit der anderen, auch auf molekularbiologischer und immunologischer Ebene. Auch das Profil eines jeden Tumors ist einzigartig. Jeweils individuelle Mutationen und Zellveränderungen machen den Unterschied. Das macht sich die molekulare Tumortherapie zunutze.
Der erste Schritt in der molekularen Tumortherapie: Das Tumorgewebe wird im Labor insbesondere auf seine spezifischen Zellmutationen und weitere Veränderungen hin untersucht. Neue diagnostische molekular-genetische Methoden machen dies möglich.
Spezifik aus dem Labor
"Man sequenziert und entschlüsselt dafür die genetische Trägersubstanz der Tumorzellen. Neben den Mutationen des Tumors lassen sich weitere Veränderungen in der Tumorzelle sehr genau beschreiben. Es werden inzwischen auch immer häufiger Veränderungen mit beurteilt, die nicht direkt, sondern als Folge der Mutationen in der Zelle entstehen und ebenfalls Zielstrukturen für molekulare Therapien darstellen können. Nachfolgend wird überprüft, ob wir spezifische Medikamente zur Verfügung haben, die gezielt bei entsprechenden Veränderungen wirken. Entsprechende Untersuchungen können dazu führen, dass Mutationen entdeckt werden, die für die untersuchte Tumorart nicht unbedingt typisch sind, die dann aber mit entsprechenden Medikamenten behandelt werden."
Prof. Angela Krackhardt
Sogenannte molekulare Inhibitoren sind Substanzen, die biologische und chemische Prozesse modifizieren, einschränken oder verhindern und zielen auf die molekularen Eigenschaften der entsprechenden Krebszelle ab, die insbesondere diese Krebszellen, aber in der Regel nicht die gesunden Körperzellen charakterisieren. Dadurch werden unbeteiligte Zellen und gesundes Gewebe - anders als bei der Chemotherapie – nicht oder nur in geringem Maße angegriffen.
"Durch ein besseres Verständnis genetischer und anderer Veränderungen des Tumors, versucht man immer spezifischere und personalisiertere Therapien für die Patienten zu entwickeln, die dann ganz gezielt gegen bestimmte Mutationen in den definierten Tumorerkrankungen gerichtet sind."
Prof. Angela Krackhardt
Die Behandlung orientiert sich nach diesem Prinzip weniger - wie in der bisherigen Behandlung von Krebs - daran, ob es sich um z.B. Brustkrebs oder eine andere Krebsart handelt, sondern immer häufiger an den spezifischen genetischen Störungen, Zellveränderungen und Mutationen.
"Molekulare Therapien waren in den 1990er Jahren der erste Schritt, die Spezifität der Therapie zu optimieren und ganz gezielt tumorspezifische Mutationen anzugreifen. Ein Paradebeispiel ist die genetische Veränderung, die im Philadelphia-Chromosom vorliegt. Diese kommt bei Leukämien vor. Hier kann ganz gezielt durch einen Inhibitor ein im Tumor übermäßig aktiviertes Enzym gehemmt werden und dadurch können die Patienten sehr gezielt behandelt werden. Bei manchen Patienten, die gut auf die Therapie ansprechen, kann die Erkrankung auch nach Absetzen der Therapie nicht mehr nachgewiesen werden."
Prof. Angela Krackhardt
Unser Immunsystem besteht aus verschiedenen Bestandteilen, einer schnellen relativ unspezifischen Abwehrtruppe (das angeborene Immunsystem) und sehr spezifischen "schlauen" Zellen, die gezielt Erreger und Krebszellen erkennen können (das erworbene Immunsystem).
"Bereits im Rahmen unserer Embryonalentwicklung findet eine sogenannte Schulung unseres schlauen Immunsystems statt. So unterscheidet die spezifische Immunzelle 'fremd' von 'eigen'."
Prof. Angela Krackhardt
Wie agieren Krebszellen und Immunzellen?
Die Krebszelle ist letztendlich eine Zelle, die außer Kontrolle geraten ist.
"Wenn es erst einmal zu einer Entartung einer Zelle gekommen ist - das passiert durch entsprechende Mutationen und kann auch bei Gesunden immer mal wieder vorkommen - kann sie in der Regel auch vom Immunsystem erkannt werden, und zwar an Merkmalen, die an der Zelloberfläche verraten, dass etwas in der Zelle nicht stimmt. Die entartete Zelle präsentiert dem Immunsystem an der Zelloberfläche durch gewebeeigene Eiweiße veränderte Merkmale in Form von kurzen Eiweißstückchen, die die Veränderungen repräsentieren. Dadurch können die sogenannten T-Zellen des Immunsystems aktiviert werden."
Prof. Angela Krackhardt
Andere Immunzellen, sogenannte B-Zellen, bilden Antikörper, um an Antigenen einer veränderten Zelle anzudocken und diese zu vernichten. Dabei kann die Zelle, die das Immunsystem als "feindlich" erkennt, durch Viren oder Bakterien verändert sein. Bestimmte Antigene finden sich auch auf der Oberfläche von Krebszellen und können daher als Zielscheibe künstlich hergestellter Antikörper genutzt werden. Manchmal finden sich die Strukturen auch auf gesunden Zellen, was dann zu bestimmten Nebenwirkungen führen kann, die jedoch häufig auch gezielt behandelt werden können. Nach dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip" finden Antigen und Antikörper zusammen. An diesem Mechanismus setzt die Antikörper-Therapie an.
Das Immunsystem stimulieren
Aufgrund der Spezifität der Waffen des Immunsystems - im Gegensatz zur Chemotherapie -, werden diese Werkzeuge künstlich nachgebaut und hergestellt und immer häufiger in der modernen Krebstherapie angewendet. Herausforderung ist dabei, eine geeignete Struktur auf der Tumoroberfläche zu identifizieren, die als spezifische Zielscheibe genutzt werden kann. Bei malignen Erkrankungen des Lymphsystems aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, wie beispielsweise dem Brustkrebs, wird dieser Ansatz schon über viele Jahre erfolgreich verfolgt. Inzwischen ist es aber auch gelungen, weit mehr geeignete Strukturen zu identifizieren und damit auch andere Tumoren zu behandeln oder auch Tumorzellen, die bereits eine Resistenz gegen eine Immuntherapie entwickelt haben. Und es gibt bereits verschiedene maligne Erkrankungen, die in der ersten Linie nur noch immuntherapeutisch behandelt werden. Dennoch können, ähnlich wie bei der Chemotherapie, Resistenzen auch bei der Immuntherapie entstehen.
Antikörper im Einsatz
Der menschliche Organismus produziert ständig Antikörper, sei es gegen Bakterien, sei es gegen verschiedene andere Erreger. Die sogenannten B-Zellen übernehmen diese Produktion.
"Man kann in Tieren und später Bakterien sowie im Reagenzglas Antikörper gegen Krebs-Strukturen generieren, die Krebszellen ganz gezielt erkennen können. Nur ein Beispiel: der Antikörper Rituximab. Dieser wird beispielsweise bereits seit vielen Jahren in Kombination mit Chemotherapien bei Lymphdrüsenkrebs angewendet und es hat sich gezeigt, dass er das Gesamtüberleben der Patienten deutlich verbessern kann. Inzwischen gibt es bei Lymphdrüsenkrebs eine große Auswahl weiterer gezielter Antikörpertherapien, die sogar noch stärker verschiedene Anteile des Immunsystems stimulieren."
Prof. Angela Krackhardt
Zwar sind Antikörper Eiweißmoleküle, die normalerweise von Immunzellen produziert werden. Sie können aber auch künstlich außerhalb des Körpers hergestellt werden. Antikörper können gezielt Krebszellen erkennen und direkt das Absterben von Krebszellen verursachen, sie können durch bestimmte Veränderungen andere Immunzellen aktivieren oder zusätzlich mit toxischen Substanzen gekoppelt werden, um Tumorzellen zu bekämpfen. Antikörper können auch dazu genutzt werden, Immunzellen zu befähigen, Krebszellen zu töten.
"Sie docken spezifisch an die Krebszellen, über einen allgemeinen Anteil aber auch an ganz spezielle Immunzellen, wie T-Zellen, Natürliche Killerzellen, Makrophagen und Monozyten, an. So werden diese Immunzellen aktiviert und diese fressen dann die Tumorzelle auf oder stoßen toxische Substanzen aus, die die Tumorzelle zerstören. Andererseits können Antikörper auch durch ihre spezifische Bindung direkt die Krebszelle hemmen oder sogar zerstören. Schließlich können Antikörper auch Signale vom Tumor blockieren, die das Immunsystem hemmen. Dadurch kommt es dann zu einer Immunaktivierung und die Immunzellen zerstören die Tumorzellen. Letztendlich sind also mehrere Mechanismen möglich, nach denen die Antikörper funktionieren. Das hängt stark vom jeweiligen Antikörper ab. Das genetische Nachbauen von Antikörper-ähnlichen therapeutischen Werkzeugen hat sich in den letzten Jahren enorm weiter entwickelt und es können inzwischen auch Erkennungsmechansimen des T-Zell-Rezeptor genutzt werden, der ja die Veränderungen im Inneren der Zelle mit Hilfe gewebeeigener Merkmale erkennt. Hier kam es 2022 zur Zulassung eines ersten Therapeutikums dieser neuen Substanzklasse zur Behandlung des metastasierten Aderhautmelanoms. Der Nutzen für die Patienten mit dieser sehr aggressiven Tumorerkrankung ist hier beträchtlich. Allerdings benötigen die Patienten für diese Therapie ein spezifisches gewebeeigenes Merkmal, das nur in ungefähr der Hälfte der Patienten vorhanden ist."
Prof. Angela Krackhardt
Die Forscher James Allison und Tasuku Honjo erhielten 2018 den Nobelpreis für ihre Forschungen zu sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, mit denen eine wesentlich neue Form der Antikörper-Therapie bei Krebserkrankungen erreicht werden konnte.
Wenn Immunzellen Signale anderer Zellen erkennen, muss schnell entschieden werden, ob diese Zellen eventuell harmlos sind oder ob das Immunsystem Gegenmaßnahmen ergreifen muss. Um eine Überreaktion zu vermeiden (und damit eventuell fatale Autoimmunreaktionen zu verursachen) und auch eine Immunreaktion zu beenden, haben die T-Zellen sozusagen "interne Bremsfunktionen", nämlich sogenannte Checkpoints, die die Zellen in ihrer Aktivität und ihrem Wachstum stoppen.
Intelligente Krebszellen
Allerdings verstehen es Krebszellen auch, diesen Mechanismus zu unterbinden (um im Bild zu bleiben: auf die Bremse zu drücken) und damit die Immunantwort zu unterdrücken. Dabei wird die Kommunikation zwischen Krebszellen und Immunzellen über Eiweiße, die an der Oberfläche der entsprechenden Zellen ausgeprägt sind, vermittelt.
"Eine zentrale Achse stellt dabei die sogenannte PD1/PD-L1-Achse dar. PD-L1, das auch auf der Oberfläche von Tumorzellen ausgebildet wird, bindet an PD1, dem Rezeptor auf der T-Zelle. Dadurch wird durch den Tumor ein Signal an die T-Zelle vermittelt, das die Immunzelle müde macht oder sogar zum Sterben bringt."
Prof. Angela Krackhardt
So bremst die Krebszelle auf diese Weise die Immunzelle mit ihren eigenen Mitteln aus.
"Zusammenfassend: Basierend auf diesen bahnbrechenden Forschungsergebnissen wurden nachfolgend klinisch anwendbare Antikörper entwickelt, die diese Kommunikation zwischen der Tumorzelle und der Immunzelle blockieren - das sind die Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Dadurch bleibt die Immunzelle aktiv und kann die Tumorzelle nachhaltig zerstören."
Prof. Angela Krackhardt
Durchbruch beim Schwarzen Hautkrebs
Zugelassen sind diese Antikörper inzwischen für die Therapie verschiedenster Krebsarten – beispielsweise dem Melanom, Lungenkrebs, Tumoren, der Hals-Nasen-Ohren Region, des Gastrointestinaltrakts, der Leber wie auch des Urogenitaltraktes und auch bei Lymphomen. Manche Tumorarten sprechen allerdings weniger oder gar nicht auf die Therapie mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren an – bei anderen zeigten sich sehr gute Ergebnisse: z.B. beim Melanom, dem Schwarzen Hautkrebs. Schon früher wurde beim Schwarzen Hautkrebs erforscht, inwiefern sich eine Stimulation des Immunsystems z.B. mit Zytokinen auf die Heilungschancen auswirkt. Mit mäßigem Erfolg. Immun-Checkpoint-Inhibitoren brachten den Erfolg.
"Mit den Checkpoint-Inhibitoren haben wir bei dieser Erkrankung tatsächlich einen enormen Durchbruch erzielt. Noch vor 15 Jahren hatte ein Patient mit metastasierten schwarzen Hautkrebs eine sehr schlechte Prognose und Langzeitüberlebenswahrscheinlichkeit. Es handelte sich also um eine zumeist tödlich verlaufende Erkrankung. Und durch diese neuen Therapien hat sich das Langzeitüberleben für einen großen Teil der Patienten deutlich verbessert. Diese Therapie kann jetzt wirklich sehr vielen Patienten helfen."
Prof. Angela Krackhardt
Ein Grund liegt auch in der Struktur des Tumors. Ein Melanom hat in der Regel viele Mutationen und verändert sich genetisch nicht so stark über die Zeit wie manch andere Krebsgeschwulst, z.B. der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Tatsächlich hat man bei vielen Tumorerkrankungen eine Korrelation zwischen der Anzahl der im Tumor gefundenen Mutationen sowie der Verschiedenheit der einzelnen Tumorzellen untereinander und dem Ansprechen auf bestimmte Immuntherapien festgestellt.
"Beim Pankreas-Karzinom, beispielsweise, entstehen häufig kleine Sub-Gruppen von Tumorzellen, die sich voneinander unterscheiden. Und das ist beim Melanom in der Regel anders. Das führt dazu, dass sich das Immunsystem beim Melanom nicht dauernd an eine neue Situation anpassen muss und so einfach leichteres Spiel hat. Darüber hinaus ist die vom Tumor veränderte Umgebung eine große Herausforderung für die Immunzellen. Hier bedarf es dringlich weiterer Forschung."
Prof. Angela Krackhardt
Verabreicht werden diese Medikamente als Infusion.
Forscher versuchen, das Prinzip, nach dem man mit Antikörpern gegen Krebszellen vorgeht, noch weiter auszureizen. Die CAR-T-Zell-Therapie ist sozusagen die nächste Stufe. T-Zellen des Immunsystems sind in der Lage, virus-infizierte Zellen und Krebszellen anzugreifen. Bei vielen T-Zellen ist deren Spezifität allerdings unbekannt und sie sind eventuell insbesondere bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen auch schon ermüdet oder gar nicht mehr vorhanden. Ziel der CAR-T-Zell-Therapie ist es, die T-Zellen genetisch so zu verändern, dass sie mit einem künstlichen Rezeptor definierte Oberflächenstrukturen auf Tumorzellen erkennen und diese dann zerstören. Ein Verfahren, das primär in den USA entwickelt wurde und eine weitere Neuerung auf dem Gebiet der Krebs-Immuntherapien darstellt, die nun zunehmend auch bei uns zur Verfügung steht.
T-Zellen werden aus dem Blut von Krebspatienten gewonnen und erhalten gentechnisch einen künstlichen Rezeptor, den sogenannten CAR-Rezeptor (Chimeric Antigen Receptor). Er lenkt die solchermaßen aufgerüsteten Zellen auf genau definierte Antigene. Die betroffenen Patienten erhalten dann diese gentechnisch veränderten Zellen zurück. Durch die Veränderung erkennen diese nun bestimmte Tumor-Antigene, die die Krebszellen auf ihrer Oberfläche tragen, und greifen diese an. Als besonders wirksam gilt diese Therapie bei Lymphomen und dem multiplen Myelom, wofür sie auch in Deutschland zugelassen ist.
"Inzwischen gibt es eine erste Zulassung bein einem besonders aggressiven soliden Tumor, dem kleinzelligen Lungenkrebs, was besonders ermutigend ist. Aktuelle Forschungsprojekte versuchen darüber hinaus, diese künstlichen Rezeptoren noch weiter zu verändern, so dass die Wirkung möglicherweise noch verbessert werden kann. Hierfür wird in Fachkreisen der englische Begriff 'T-cell Engineering' verwendet. Dabei kommen nicht nur Antikörper-abhängige Rezeptoren, die direkt Oberflächenstrukturen auf der Krebszelle erkennen können, sondern zunehmend auch T-Zell-Rezeptoren die über die körpereigene Präsentation Veränderungen in der Zelle aufspüren können, zur Anwendung. Gerade in München wird hierzu intensiv geforscht."
Prof. Angela Krackhardt
Insbesondere bei der Behandlung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren und CAR-T-Zellen können starke Nebenwirkungen auftreten, denn die Kontrollsysteme des Immunsystems sind teilweise außer Gefecht gesetzt. Das Resultat sind gesteigerte entzündliche Reaktionen und Autoimmunerkrankungen, d.h. die Immunantwort kann gegen den eigenen Körper gerichtet werden.
Die Folgen einer solchen überschießenden Reaktion: Schwere Allgemeinreaktionen sowie spezifische Entzündungen der Organe, wie beispielsweise des Darms, der Leber, der Niere, die lebensbedrohlich sein können.
"Prinzipiell kann, z.B. bei der Behandlung mit den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, jedes Gewebe betroffen sein. Derzeit können wir nicht vorauszusagen, welcher Patient welche Nebenwirkung bekommt."
Prof. Angela Krackhardt
Das Immunsystem jedes Patienten reagiert sehr individuell.
"Wir haben momentan noch zu wenig Wissen darüber, wie wir die Therapien exakt dosieren können, d.h. wie stark müssen wir das Immunsystem jedes einzelnen Patienten anregen, damit wir den gewünschten Behandlungs-Effekt ohne schwere Nebenwirkungen erzielen"
Prof. Angela Krackhardt
Dazu brauche es erst noch weitere Forschungen. Werden beispielsweise genetisch modifizierte CAR T-Zellen zu stark aktiviert, können damit eine große Menge bestimmter Botenstoffe freigesetzt werden. So kann es zu schwerwiegenden Reaktionen mit heftigen Nebenwirkungen kommen, z.B. dem Zytokin-Sturm-Syndrom. Zytokine sind Eiweißverbindungen, die als Botenstoffe immunologische Reaktionen und Entzündungsprozesse steuern.
"Und das kann zu einem ähnlichen Krankheitsbild wie bei einem anaphylaktischen Schock führen. Dem Patienten kann es dann unter Umständen sehr schnell sehr schlecht gehen. Es ist wichtig, dass Arzt und Patient für diese Situationen gut vorbereitet sind. Dann kann man diese Reaktionen in der Regel auch gut behandeln."
Prof. Angela Krackhardt
Prof. Angela Krackhardt legt daher großen Wert darauf, diese Nebenwirkungen mit ihren Patienten ausführlich zu besprechen.
"Die Anwendung einer bestimmten Therapie ist immer eine individuelle Abwägung. Man sollte immer eine Nutzen-Risiko-Analyse durchführen, das heißt, die Risiken der Nebenwirkungen mit den Risiken der Tumorerkrankung, aber auch der erwarteten Wirksamkeit der Therapie sowie dem Alter und der Lebenserwartung des Patienten in Verbindung setzen. Das heißt, was bringt eine Therapie - im Gegensatz zu dem Schaden, den man möglicherweise anrichten kann. Es gibt Patienten, die vielleicht auch schon älter sind, die diese Nebenwirkungen aufgrund anderer Erkrankungen schlechter vertragen würden und gegebenenfalls auch nicht erleben möchten. Das muss man dann berücksichtigen. Aber was man schon sagen kann: Diese Risiko-Nutzen-Analyse geht bei den aktuellen zugelassenen Immuntherapien häufig in Richtung Behandlung, da die Nebenwirkungen in der Regel gut beherrscht werden können."
Prof. Angela Krackhardt
Ein Ziel weiterer Forschung ist es, die immunologischen Auswirkungen von Mutationen, durch die Krebszellen entarten, besser zu verstehen und zu analysieren. Nur so kann auch das Immunsystem immer gezielter stimuliert werden. Ganz im Sinne der modernen Krebstherapie: weg von Medikamenten, die zwar bei vielen Patienten eingesetzt werden können, aber häufig auch sehr schädlich für gesundes Gewebe sind, hin zu sehr abgestimmten Medikamenten, die gezielt und personalisiert eingesetzt werden können. Individuelle Mutationen im Tumor können unter Umständen hervorragende Zielstrukturen darstellen. Nachteil ist, dass die Herstellung entsprechender Therapeutika derzeit noch sehr teuer und zeitaufwendig ist. Hier kann möglicherweise die künstliche Intelligenz zukünftig helfen, die Therapien kostengünstiger zu machen. Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich zunehmend Hinweise, dass die T-Zell-Rezeptoren sich in der Stärke ihrer Antwort unterscheiden und die T-Zellen mit etwas weniger starken Rezeptoren möglicherweise einen längeren Atem haben. Die Komplexität nimmt also nochmals auf verschiedenen Ebenen zu und es bedarf weiterer intensiver Forschung, um das Potential voll auszuschöpfen.
Auch Impfungen könnten das körpereigene Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen scharf stellen.
"Ein Ansatz, der sehr interessant ist, ist die sog. Neo-Antigen-Vakzinierung. Das ist eine Therapie, für die die tumor-spezifischen Mutationen im Tumor von jedem Patienten gezielt bestimmt werden. Aus diesen Informationen wird dann, ähnlich bei COVID19 oder anderen Viruserkrankungen, ein Impfstoff generiert, der das Immunsystem ganz gezielt auf diese Mutation hinweist und so den Effekt von Immuntherapien verstärken soll. Die klinische Forschung ist hier schon sehr weit vorangeschritten und die Ergebnisse großer Studien werden mit großer Spannung erwartet."
Prof. Angela Krackhardt
Bei allen Forschungen verfolge man immer das Ziel, die sogenannte "spezifische Antwort" des Immunsystems so zu steuern, dass nicht auch gesundes Gewebe angegriffen wird.