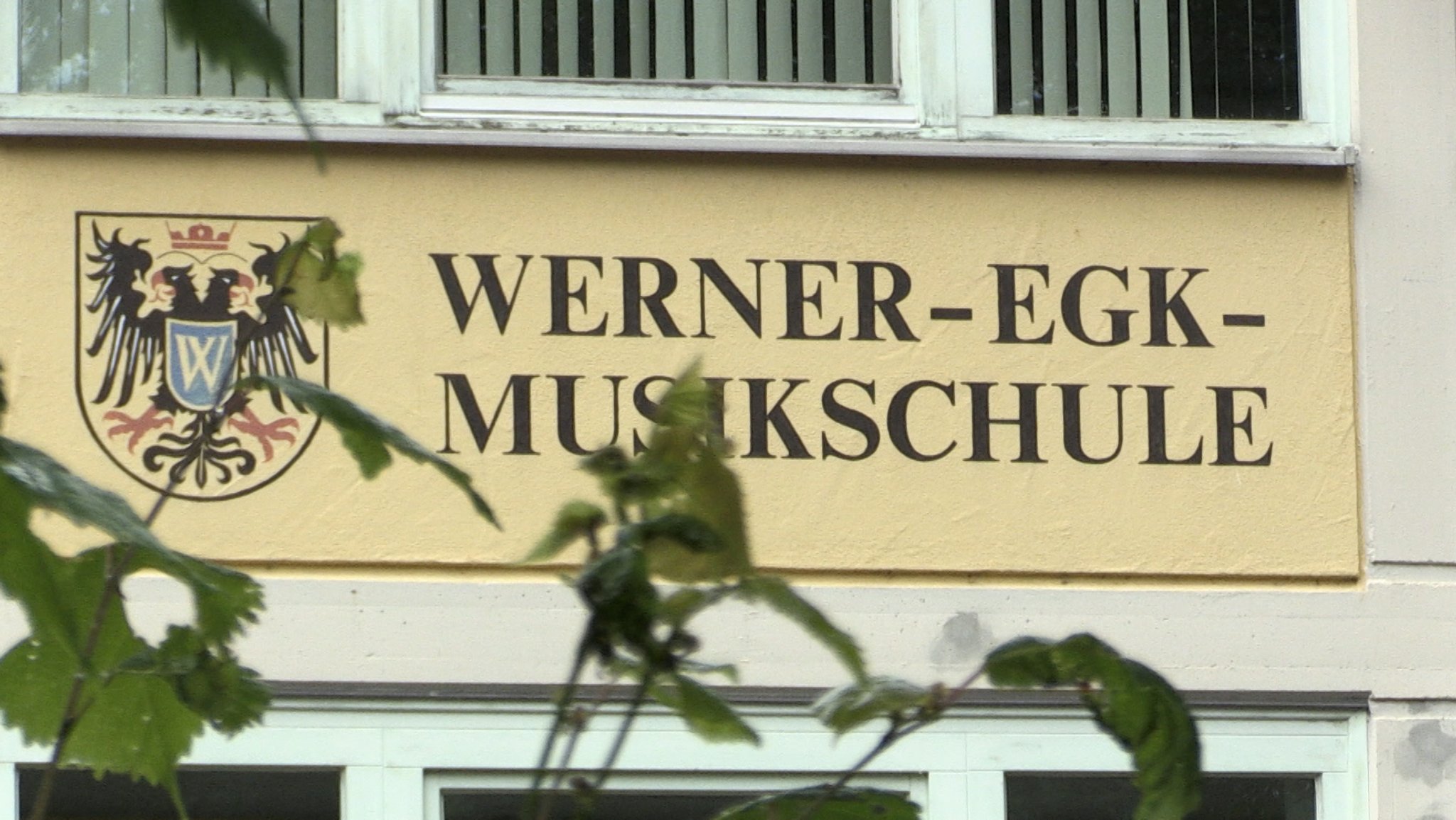Der Donauwörther Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit entschieden, dass die Werner-Egk-Musikschule der Stadt umbenannt wird. Grund dafür ist eine neue Studie, die zeigt, dass sich der im Donauwörther Stadtteil Auchsesheim 1901 geborene Komponist unter anderem auch privat jahrelang judenfeindlich und rassistisch geäußert hat. Der Werner-Egk-Platz in Auchsesheim behält jedoch seinen Namen.
Grünen geht Entscheidung nicht weit genug
Gegenstimmen gab es nur von den fünf Stadträten der Grünen und dem Stadtrat der ÖDP. Der Grund: Die von einem Arbeitskreis formulierten Konsequenzen gehen ihnen nicht weit genug. Nach Meinung der Grünen-Fraktion hätte auch der Werner-Egk-Platz umbenannt werden müssen. Die Straßenbenennung sei eine Ehre für die gewürdigten Personen, so regle es auch die Ehrensatzung der Stadt. Das könne für Werner Egk aber nicht mehr gelten.
Das sieht die CSU-Fraktion anders. Fraktionsvorsitzender Jonathan Schädle sagte in der Sitzung, wenn Namen nicht mehr präsent seien, könne man auch keine Lehren daraus ziehen. Der Fokus müsse jetzt auf möglichst breiter Information und Aufklärung liegen.
Straßenname als Zeitzeugnis
Oberbürgermeister Jürgen Sorré (parteilos) sagte dem BR, er trage die Entscheidung der Arbeitsgruppe mit. Dass der Werner-Egk-Platz nicht umbenannt wird, begründete er so: "Auch über den Weg Straßennamen oder Ortsbezeichnungen dokumentiert man ein Stück weit Stadtgeschichte. Und in der Stadtgeschichte gibt es durchaus auch dunkle Zeiten, auch in Donauwörth und damit kann man auch argumentieren: Ist das ein Zeitzeugnis an diese dunklen Zeiten? Wichtig ist eben, dass man es einordnet!" Deshalb sollen auch der Werner-Egk-Platz und alle anderen Orten, die nach Werner Egk oder seiner Musik benannt sind, mit Hinweistafeln versehen werden.
"Egk war von antisemitischem und rassistischem Gedankengut erfasst"
Die Studie der Musikwissenschaftlerin Anna Schamberger von der Ludwig-Maximilians-Universität München zu einem eindeutigen Ergebnis: "Egk war von rassistischem, antisemitischem Gedankengut erfasst und beteiligte sich mit seinen musikalischen Werken und Publikationen aktiv an Ausgrenzung und Diffamierung", so schreibt es Schamberger in einer Stellungnahme an den Stadtrat. Auch im familiären Bereich habe er Ideologien des Nationalsozialismus vertreten. Außerdem seien auch nach 1945 weiter antisemitische Tendenzen und NS-Rhetorik bei Egk festzustellen. Es habe sich kein Anzeichen von Betroffenheit oder des Bedauerns über die Verbrechen des NS-Regimes gefunden, so die Wissenschaftlerin.
Komponist beschimpfte Juden
Der BR konnte im Donauwörther Stadtarchiv Teile des in der Studie untersuchten Briefwechsels einsehen. An vielen Stellen zeigen sich darin antisemitische Äußerungen. So schreibt Werner Egk 1929, also vier Jahre vor der Machtergreifung der Nazis, an seine Frau über einen Besuch im Berliner Staatstheater: "Publikum urjüdisch, Strawinsky selbst wie ein kleiner, sich windender Affe; Klemperer ein Oberjude, die Kapellmeister der Oper alle vier Juden, die Solisten Juden, es war wie wenn man gar nicht dazugehörte. An leitender Stelle des Staatstheaters sind 16 Männer, darunter 15 Juden, ein Nicht-Jude, der aber kein Deutscher, sondern Westschweizer ist." In den Briefen bezeichnet er außerdem einen amerikanischen Film als "Unkunst" oder beschreibt an anderer Stelle SS-Funktionär Hans Hinkel, der sich im Hitlerregime mit Kulturfragen beschäftigte, als "sympathisch". Einen Komponisten-Kollegen beschimpft Egk als "schissigen Isrealiten".
Straßenumbenennungen sind grundsätzlich möglich
Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung des Stadtrates, den Namen des Werner-Egk-Platzes beizubehalten, bemerkenswert. Denn in der „Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Donauwörth“, steht, dass Umbenennungen möglich sind. Das sei der Fall, „wenn […] nachträgliche offenkundige Tatsache es für angebracht erscheinen lassen“, so steht es in der Satzung. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass es für die große Mehrheit des Stadtrates offenbar nicht angebracht war, den Straßennamen zu ändern – trotz der Studie, die Egks Judenfeindlichkeit und fehlende Reue eindeutig belegt. Oberbürgermeister Jürgen Sorré sagte dem BR jedoch: „Jede Entscheidung kann man aber am Schluss diskutieren. Und wenn jetzt von Seiten der Bürgerschaft kommt: Ihr habt da die falsche Entscheidung getroffen, wir möchten es anders haben, dann können wir da gerne noch mal drüber sprechen!“
Büste und Brunnen bleiben erhalten
Die vom Stadtrat im Paket beschlossenen Konsequenzen zum Umgang mit Egk beinhalten auch eine Überarbeitung der Ausstellung in der Werner-Egk-Begegnungsstätte. Auch das Glockenspiel am Donauwörther Rathaus soll künftig keine Musik Egks mehr spielen. Beibehalten werden jedoch die Namen des Werner-Egk-Platzes und der Zaubergeigenstraße, die sich auf ein Werk Egks bezieht, das laut Studie aber auch auf eine judenfeindlich konnotierte Erzählung zurückgeht. Vor Ort sollen jedoch entsprechende Hinweise angebracht werden. Das gilt auch für die Werner-Egk-Büste in Auchsesheim und den Zaubergeigenbrunnen in Donauwörth.
"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!