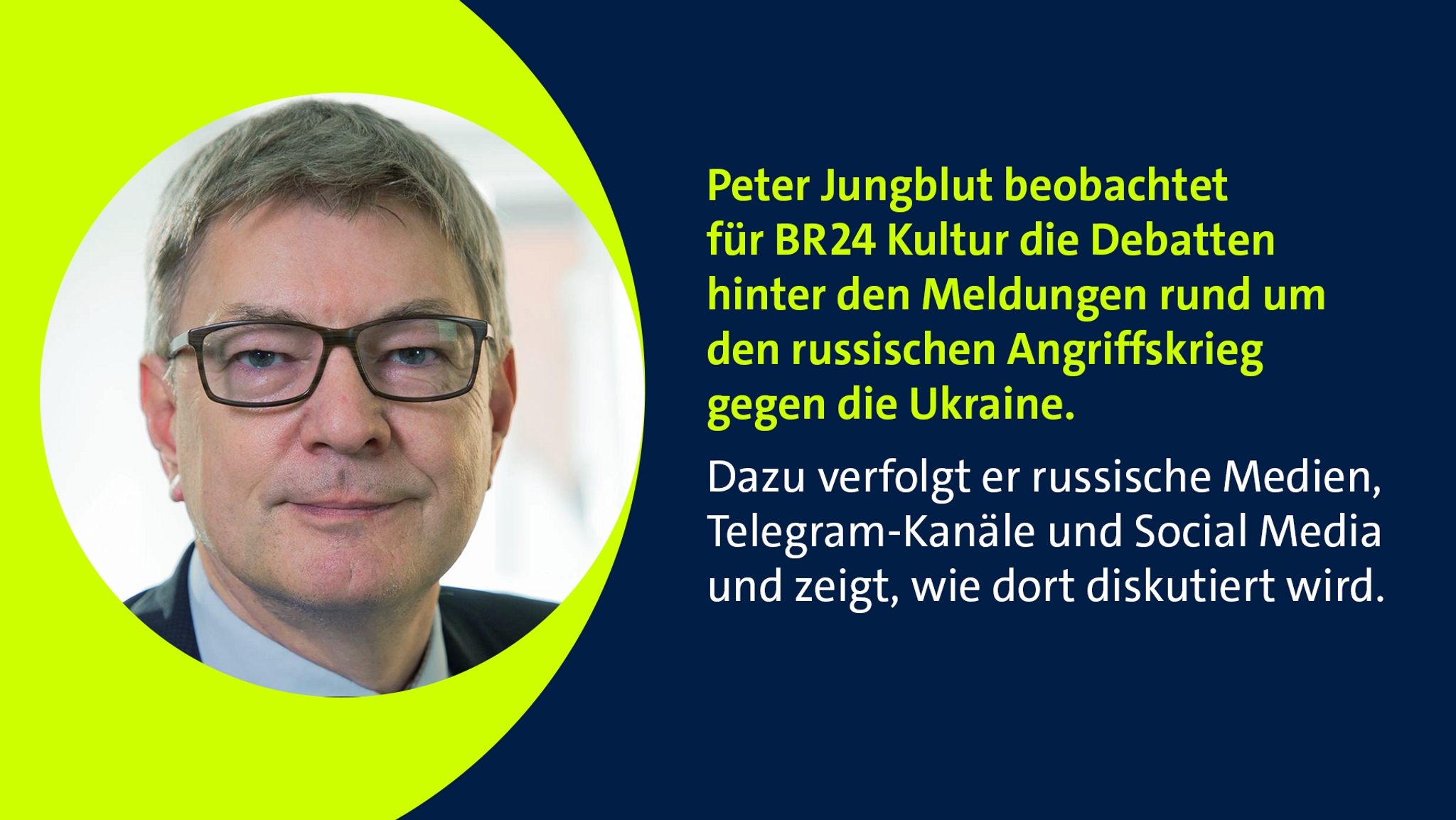"Ich will nicht verhehlen und werde nicht müde werden, es zu wiederholen: Ich habe Angst", so der russische Historiker Modest Kolerow zum 3. Jahrestag von Putins Angriff auf die Ukraine: "Unsere Geschichte hat uns von jeher gelehrt, dass unsere Diplomatie die Leistungen unserer heldenhaften Armee, die im Krieg mit Blut und Menschenleben bezahlt werden, stets verdunkelte. Ich möchte nicht, dass es dieses Mal wieder passiert."
"Vorwürfe gegen Militär unangebracht"
Im Übrigen nennt der Historiker zwei aus seiner Sicht betrüblichen Beispiele für das "Versagen" der russischen Diplomatie trotz militärischer Erfolge: 1762 wechselte der frisch inthronisierte Zar Peter III. im Siebenjährigen Krieg nach verlustreichen Schlachten plötzlich die Seite und verhinderte dadurch den "Untergang" Preußens. Zuvor waren im Kampf gegen den preußischen König Friedrich II. rund 120.000 Russen gefallen. 1878 errang die russische Armee einen Sieg über das Osmanische Reich, der allerdings durch das diplomatische Eingreifen der europäischen Mächte auf dem damaligen "Berliner Kongress" weitgehend neutralisiert wurde.
Ähnliche Bedenken hat Militärblogger Roman Aljechin (192.000 Follower). Er fragt sich und seine Leser: "Wenn das Ziel des Krieges laut [dem preußischen Kriegstheoretiker Carl von] Clausewitz und anderen darin besteht, Frieden zu den Bedingungen des Siegers zu schließen, warum haben dann alle den Eindruck, dass Amerika die Bedingungen festlegt?"
"Erwartungen maximiert"
"Aus militärischer Sicht scheiterte die Spezialoperation etwa innerhalb einer Woche, als der Plan 'Kiew in drei Tagen' plötzlich Risse bekam und schließlich völlig auseinander fiel", so Politologe Anatoli Nesmijan (121.000 Fans) in seiner 3-Jahres-Bilanz von Putins Angriffskrieg: "Es ist wohl unangebracht, hier Vorwürfe gegen das Militär zu erheben, weil der Plan selbst, wonach die ukrainische Führung fliehen und ihre Armee die Waffen niederlegen sollte, scheiterte."
Aus Unvernunft werde der Krieg wohl noch "sehr lange" dauern: "Jede Logik hätte verlangt, nach dem Scheitern des Blitzkriegs einen Waffenstillstand auszuhandeln, um das Ergebnis zu besiegeln. Doch beide Seiten entschieden, dass der gesunde Menschenverstand für sie nicht galt und maximierten ihre Erwartungen über alle vernünftigen Erwägungen hinaus."
BR24
"Als erstes möchte ich bemerken, dass diktatorische Regime selten durch einen Krieg am Rande des Zusammenbruchs stehen", argumentiert Politologe Wladislaw Inosemtsew. Deshalb sei Putins Regime auch weniger mit umstrittenen Regierungen wie in Argentinien, sondern mehr mit dem autoritären Irak vergleichbar. Allenfalls Streitereien innerhalb der Kreml-Elite könnten für eine Destabilisierung sorgen: "Das Regime der Kriegsjahre ist viel stabiler, als es in Friedenszeiten den Anschein hatte."
"Sowieso weitgehend machtlos"
Außerdem mache der Krieg in gewisser Weise "süchtig", so Inosemtsew: "Nach dem ersten Schock, spontanen Protesten, massenhafter Auswanderung und der Erwartung eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs stabilisierte sich die Situation in der Gesellschaft und es machte sich Routine breit. Die Menschen gewöhnten sich an die neue Realität, entdeckten ihre Vorteile, redeten sich ein, dass es viel schlimmer hätte kommen können oder erkannten, dass sie sowieso weitgehend machtlos sind."
Der Kreml habe in den letzten drei Jahren paradoxer Weise vor allem die Interessen der USA bedient, heißt es in einer weiteren sehr aufschlussreichen Analyse. Russland sei durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Kaukasus, in Zentralasien und in Syrien in die Defensive geraten und habe unwillentlich die Position der Türkei und der NATO gestärkt.
"Wir wollen Platz an der Sonne"
"Das Überleben der Wirtschaft während dieser drei Jahre ist eines der wichtigsten und unerwarteten Ergebnisse", bemerkt Politologe Ilja Graschtschenkow. Was die "Sicherheitsreserven" betreffe, gebe es allerdings viele Fragezeichen. Propagandist Dmitri Konanischin rühmte derweil wie viele Gesinnungsgenossen die vermeintliche Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: "Der Krieg hat uns auf die Probe gestellt und uns gezwungen, uns daran zu erinnern, was Nächstenliebe wirklich bedeutet."
Derzeit kämpfe jedes Land um einen "Platz an der Sonne" in der neuen Weltordnung, meinte Starblogger Juri Podoljaka (3,1 Millionen Fans) und zitierte damit eine Reichstagsrede des späteren deutschen Reichskanzlers Bernhard von Bülow (1849 - 1929) vom 6. Dezember 1897: "Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne." Das allerdings war in der Ära von Imperialismus und Kolonialismus.
Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.
"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!